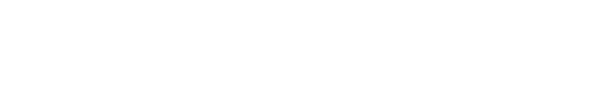Selen ist ein Spurenelement im menschlichen Körper und spielt möglicherweise eine überraschend wichtige Rolle im Schutz vor Krankheiten, insbesondere bei Dickdarmkrebs. Weltweit leiden Hunderte Millionen Menschen an einem Selenmangel, meist ohne es zu wissen. Frühere Studien haben gezeigt, dass ein niedriger Selenstatus mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung von Darmkrebs verbunden ist. Interessanterweise reichern Tumorzellen jedoch aktiv Selen an, um sich vor einer bestimmten Form des Zelltods, der sogenannten Ferroptose, zu schützen. Das bedeutet: Selen kann sowohl zur Krebsprävention beitragen als auch das Wachstum bestehender Tumoren unterstützen.
Stefanie Brezina und Andrea Gsur haben gemeinsam mit Kollegen der Charité in Berlin dieses Paradoxon näher untersucht. Dabei analysierten sie Plasmaproben aus der „Colorectal Cancer Study of Austria“ (CORSA). Insgesamt wurden 111 Proben von Darmkrebspatienten, 255 Adenom-Proben sowie 153 Kontrollen (Personen mit unauffälliger Koloskopie) herangezogen. Gemessen wurden vier Marker des Selenstatus: der Gesamtselen-Gehalt, die selenabhängigen Proteine GPx3 und SELENOP sowie Autoantikörper gegen SELENOP.
Während Gesamtselen und GPx3 zwischen den Gruppen keine wesentlichen Unterschiede zeigten, waren die SELENOP-Werte bei Krebspatienten signifikant niedriger. Zudem wiesen über 5 % der Krebspatienten Autoantikörper gegen SELENOP auf, im Vergleich zu weniger als 1 % bei den Kontrollen.
Am bedeutendsten war jedoch der Zusammenhang zwischen höheren SELENOP-Werten zum Zeitpunkt der Diagnose und einer besseren Langzeitüberlebensrate, selbst nach Berücksichtigung anderer Gesundheitsfaktoren. Die Integration von Selen-Biomarkern, insbesondere SELENOP, in bestehende klinische Prognosemodelle führte zu deutlich verbesserten Vorhersagen über den Krankheitsverlauf. Da die SELENOP-Werte stark von der Ernährung abhängig sind, könnten Defizite potenziell durch gezielte Ernährung oder Supplementierung ausgeglichen werden, eine vielversprechende Perspektive für eine individualisierte Krebstherapie.
Darüber hinaus identifizierte eine datenbasierte Clusteranalyse drei unterschiedliche Patientengruppen basierend auf Selenmarkern, eine davon mit einem deutlich erhöhten Sterberisiko. Dies unterstreicht das Potenzial des Selen-Profilings als Instrument zur personalisierten Behandlung und Nachsorge.
Publikation:
Colorectal cancer mortality is associated with low selenoprotein P status at diagnosis
Redox Biol. 2025 May 24:84:103701. doi: 10.1016/j.redox.2025.103701.
Über Stefanie Brezina
Stefanie Brezina studierte Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Ihre Promotion schloss sie 2018 in der Forschungsgruppe von Andrea Gsur am Zentrum für Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien ab. Im Rahmen ihrer Dissertation führte sie eine groß angelegte Metabolomics-Studie zur Identifikation von Biomarkern entlang der Entstehung von kolorektalem Krebs durch. Einen Teil ihres Doktorats verbrachte sie am Huntsman Cancer Institute in Salt Lake City. Aktuell arbeitet Stefanie Brezina als PostDoc in der Forschungsgruppe von Andrea Gsur. Ihr Fokus liegt auf der molekularen Epidemiologie und dem Einsatz omics-basierter Methoden, zur Identifikation neue Biomarker.